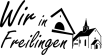Anlässlich des Volkstrauertages möchten wir auf WiF noch einmal an das besondere Interview eines Zeitzeugen in Freilingen erinnern, der erst vor kurzem leider im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Er hinterlässt aber mit seinen niedergeschriebenen Erinnerungen ein eindringliches Mahnmal und ein bleibendes Zeugnis von den Grausamkeiten des letzten Weltkrieges, das es immer wieder wert ist, gelesen zu werden...zum Gedenken am heutigen Volkstrauertag und in Erinnerung an Matthias Korth, der als 17jähriger Soldat regelrecht durch die Hölle ging.

WIF: Wie alt waren Sie, als Sie als Soldat eingezogen wurden und wie sahen die ersten Wochen als Soldat aus ?
Matthias Korth : Im November 1943 bin ich mit 17 Jahren eingezogen worden. Wir wurden nach Nimwegen in Holland gebracht und dort direkt feldmarschmäßig ausgerüstet. Von dort ging es nach Russland in die Nähe der Ostfront. Da wir noch keinerlei militärische Ausbildung hatten, haben wir zuerst Bunker und neue Stellungen gebaut. Dann kam ich nach Dünaburg ( Anm. heute Daugavpils in Lettland) zur Ausbildung. Dort wurden wir richtig hart ausgebildet. Morgens um vier Uhr fing der Dienst schon an, nachher noch früher. Wir sollten „fronthart“ werden.
WIF: Wie erlebten Sie die Kampfhandlungen und wann wurden Sie gefangen genommen ?
Matthias Korth: Einige Wochen nach unserer Ausbildung wurden wir aufgeteilt und kamen dann in die Nähe von Leningrad an die Narva-Front. Da haben wir harte Kämpfe gehabt. Die Russen schlugen dort stark durch. Weil der Mittelabschnitt der Ostfront zusammengebrochen und unsere Einheit noch kampfstark war, wurden wir hier abgezogen und nach Wilna (Anm. heue Vilnius, Hauptstadt von Litauen) verlegt, um wenigstens diese Stadt zu halten. Weit vor der Stadt wurden wir abgeladen. Dort kamen uns schon die ganzen Flüchtlinge aus der Stadt entgegen, viele Frauen und Kinder mit Handwagen, die die Straßen verstopften. Auch zahlreiche Verwundete waren dabei, da es viele Lazarette in Wilna gab. Jeder sah zu, dass er aus der Stadt wegkam. Einer schrie uns noch zu „Mensch, haut doch ab!“, aber wir mussten geschlossen hineinmarschieren.
In der Stadt haben wir noch ein gutes Essen bekommen und bezogen dann die Stellungen am Rande der Stadt. Dann kamen die russischen Panzer angerollt, alle mit aufgesetzter Infanterie mit Maschinenpistolen. Einer kam direkt auf den Hang zu, an dem ich mit einem anderen Soldaten lag. Ich dachte nur, jetzt ist es aus, wir hatten uns beide schon abgeschrieben.
Auf einmal kam ein Gegenangriff von einer „Acht-Acht“, die in der Nähe aufgestellt war ( Anm. deutsches Flugabwehrgeschütz, das auch gegen Bodenziele eingesetzt wurde) und die schlugen durch. Das war ein Getöse, als ob die Welt unterging und die Hälfte der russischen Panzer, es waren insgesamt wohl 15 Stück, flog in die Luft. Der Rest zog sich daraufhin zurück. Übrig blieb die dahinter aufrückende russische Infanterie, die in Stellung ging. Wir erhielten dann den Befehl, erneut zu stürmen. Dabei haben wir hohe Verluste erlitten, sehr hohe. Wir mussten dann die Verwundeten zum Verbandsplatz tragen und anschließend wieder zurückkehren. Wir sollten schließlich eine Schützenkette bilden, uns also hintereinander aufstellen. In diesem Moment schlug eine Granate von einem vorrückenden russischen Panzer zwischen uns ein. Dabei wurde wieder die Hälfte verwundet, es gab auch etliche Tote.
Mich hat es dabei auch erwischt. Ich hatte beide Beine voller Splitter und stand mit meinen Füßen in meinen Schuhen im Blut. Ich habe mich selbst zum Verbandsplatz geschleppt, den Weg kannte ich ja. Das war ein einfaches öffentliches Gebäude, in dem die Verwundeten behandelt wurden und das selbst schon so beschädigt war, dass man von innen in den Himmel gucken konnte.
Dort wurde ich verbunden und bekam ein Schild umgehängt auf dem stand „Liegend transportieren“. Wir wurden in den Keller verlegt, wo keiner mehr nach uns schaute. Es gab auch keine Verpflegung mehr. Immer weiter kamen neue Verwundete hinzu. Wir erfuhren dann, dass die Brücke über den Fluss Düna, also der Weg aus der Stadt hinaus, von den Deutschen gesprengt worden war, so dass niemand mehr flüchten und die Stadt verlassen konnte. Auch die Verwundeten konnten daher nicht abtransportiert werden. Nach einigen Tagen erschienen die „Kettenhunde“, die Wehrmachtspolizei und die holten alles raus was noch irgendwie laufen konnte, weil man dringend Soldaten für die Stellungen brauchte. Man hatte ja keine Leute mehr. Mich wollten sie unbedingt mitnehmen. Ich hielt ihnen meinen Schild hin „Hier, ich kann nur liegend transportiert werden“, so dass man mich verschonte, aber viele andere Verwundete, die irgendwie noch kriechen konnten, mussten mitgehen, um die Stadt zu halten.
Auf einmal hieß es unter den Verwundeten, dass jeder, der noch irgendwie laufen konnte, sich aufmachen sollte, um die Stadt zu verlassen. Es gab noch drei LKWs zum Abtransport, mit denen man abends am Rand der Stadt den Durchbruch wagen wollte. Ich wollte auch unbedingt mit raus. Die Fahrzeuge waren schon lange voll. Viele hängten sich von außen dran, an das Schutzblech und die Rücklichter und ließen sich nachschleifen. Wir fuhren zwar ein Stück hinaus. Letztlich war der weitere Durchbruch aber unmöglich, weil ja die Brücke über den Fluss gesprengt war und wir nicht über den Fluss kamen. Zudem brannte es an allen Ecken, überall war Qualm. Auf einmal lief schöne deutsche Marschmusik aus den Lautsprechern der Russen. Plötzlich war es still, man hörte auch keinen Beschuss mehr und die deutschen Soldaten wurden aufgefordert, sich zu ergeben : “Deutsche Soldaten, legt die Waffen nieder, es warten 1000 weiße Betten mit 1000 tollen Weiber auf euch“. Alle erstarrten. Dann ging auf einmal der Beschuss wieder los, wobei wieder viele getötet wurden, da man in der Zwischenzeit wieder genug Munition herbeigeschleppt hatte. Der Durchbruchsversuch war schließlich ein totaler Reinfall.
Ich wollte dann wieder zurück in die Stadt in ein Lazarett. Ich kam an ein großes Krankenhaus. Die Tür stand offen, so dass ich hineinschauen konnte. Alles war voll Blut. Es sah aus wie in einem Schlachthaus. Ein Schreien und Gestöne überall. An der Seite im Flur standen 4 Waschkörbe, die voll waren mit amputierten Armen, Beinen und Händen. Man bekam keine Zeit, die Körbe auszuschütten. Es kamen immer weiter neue Verwundete. Mit vielen anderen floh ich dann in einen kleinen Wald vor der Stadt. Dieser wurde dann aber so stark mit Granatwerfern beschossen, dass ich wieder zurück in die Stadt fliehen wollte.
Plötzlich, es war morgens um 4 Uhr am 13. Juli 1944, stand im Halbdunklen ein baumlanger Russe vor mir. Er nahm mir mein Gewehr weg und schlug es an einem Zaunpfahl kaputt. Dann zeigte er auf eine Gruppe von Gefangenen am Standrand, denen ich mich angliedern sollte. Dort standen schon ein paar hundert deutsche Gefangene. Als ich da ankam, standen an der Seite deutsche Packwagen. Ich bin dann auf einen Wagen gesprungen. Darauf lag eine Tasche mit einem vertrockneten, verschimmelten Stück Brot, einem Pullover und einer Decke drin. Es lag auch noch eine Decke auf dem Sitz.
Ich hab alles genommen und bin dann wieder zu den anderen zurück. Als die anderen Gefangenen, die schon lange da standen, das sahen, versuchten sie auch, auf die anderen Wagen aufzusteigen und sie zu plündern. Aber die Russen bemerkten das, schossen um sich und schlugen mit den Gewehrkolben auf die Gefangenen ein, so dass keiner mehr an die Wagen herankam. Ich aber habe die Sachen behalten. Ich hab den Pullover die ganze Gefangenschaft über gehabt.
WIF: Wohin sind Sie als Gefangener gebracht worden ?
Matthias Korth : Wir sind noch am Morgen meiner Gefangennahme aus der brennenden Stadt heraus marschiert, vorbei an den vielen Toten. 30 km mussten wir jeden Tag marschieren auf den berühmten Rollbahnen, so wie bei uns die Autobahnen. Dabei zogen die Russen den Gefangenen die Schuhe aus, um sie zu behalten. Ganz vorne liefen die deutschen Offiziere. Auch sie mussten ihre schönen Lackschuhe ausziehen und barfuß laufen. Sie hatten die Füße voller Blasen. Ich versuchte immer, möglichst nicht am Rand zu marschieren, wo die Posten gingen, sondern in der Mitte, wo man mich nicht sah, damit man mir die Schuhe nicht wegnahm.
Uns entgegen kam dabei ständig der russische Vormarsch. Hinten knallte es immer. Jeder, der nicht mitkam, wurde erschossen. Abends lagerten wir, wenn möglich, an irgendeinem Gewässer. Die ersten Tage wurden wir nicht verpflegt, aber wegen der nervlichen Anspannung und Belastung hat man zunächst auch gar nicht an den Hunger gedacht. Irgendwann nahm ich dann doch das Stück Brot aus der Tasche raus. Ich wollte noch den grünen Schimmel abmachen, da fielen die anderen schon darüber her. Ruck zuck war alles weg. Auch eine von den Decken wurde mir direkt in der ersten Nacht weggenommen, aber dann musste ich auch nicht so viel schleppen.
An einem Tag kamen wir an einem kleinen Ort vorbei. Da waren am Rand der Straße LKWs geparkt. Ein Russe hatte einen Eimer Wasser in der Hand und füllte gerade den Kühler bei einem LKW auf. Vor mir ging ein Gefangener, der noch eine leere Gasmaskenbüchse hatte. Er rannte zu dem russischen Soldaten hin. Die beiden sahen sich an und der russische Soldat schüttete im Wasser in seine Büchse. Ein russischer Wachposten sah dies, rannte sofort hin und schlug dem Gefangenen mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Das Blut spritzte. Danach wagte es keiner mehr, sich Wasser zu holen, obwohl wir schrecklichen Durst hatten.
Wir sind sehr weit marschiert, von Wilna nach Witebsk. Dort gab es ein „schönes“ Gefangenenlager, das die Deutschen eigentlich für die Russen gebaut hatten, schön stabil. Und wir wurden dann vorübergehend dort eingesperrt. Da in Witebsk im Hinterland die Eisenbahnstrecken noch in Ordnung waren, hat man uns wenig später in Waggons verlagert, je 50 Mann in einem ganz kleinen Waggon. Dort drin mussten wir Mann an Mann stehen. In einer Ecke war ein kleines Loch, da durch konnte man seine Notdurft verrichten. Ansonsten mussten alle Luken und Klappen zu sein. Es war Juli und sehr heiß. Jeder hatte Hunger. Die Hitze war kaum zu ertragen. Man bekam kaum Luft. Und wenn man die ganze Zeit so gestanden hatte, war man hundemüde. Wir versuchten uns dann irgendwie hinzulegen. Wie in Schichten wollten wir uns übereinander legen.
Aber der Unterste hatte schließlich zwei, drei Mann auf den Beinen liegen und fing dann an zu schreien, weil zu viel Gewicht auf ihm lastete. Dann mussten alle wieder aufstehen. Ich hatte ja noch eine der Decken. Und da in den Ecken des Waggons dicke Haken reingehauen waren, habe ich die Decke wie eine Schlaufe dort angeknüpft und bin dort hinein geklettert. Das dauerte keine viertel Stunde, da hingen schon vier in der Luft, da hing in jeder Ecke einer. Dann standen unten schon vier weniger.
Nach ein paar Tagen wurde die große Tür vom Waggon aufgerissen. Zuerst zog man die Toten alle heraus und schmiss sie auf die Erde, einfach so, wie ein Stück Holz. Dann stellte man uns zwei Pferdebeutel mit Wasser hin. Die ersten versuchten mit einem Trinkbecher oder einem Deckel vom Kochgeschirr Wasser zu schöpfen. Andere nahmen auch einfach ihre Mütze dazu. Aber die nächsten die nicht drankamen, rissen ihnen das Wasser aus der Hand. Bevor ich von oben aus der Ecke heraus sehen konnte, was dort los war, war nur noch ein nasses Knäuel übrig und es gab eine Schlägerei. Doch das Wasser war weg und wir wurden wieder eingesperrt. Am nächsten Tag ging wieder die Tür auf, Tote raus, wieder zwei Beutel hingestellt. Diesmal wurde aber ordentlich geteilt, jeder ein paar Schluck aus einem Alutrinkbecher.
Nach 8 Tagen wurden wir in Moskau ausgeladen. Dort mussten wir einen Propagandamarsch machen, weil die Russen zeigen wollten, was sie alles erbeutet hatten an Gefangenen. Wir wurden bewacht von den Posten durch die Stadt getrieben, damit uns keiner angreifen konnte. Die Frauen beschimpften uns, während uns die Kinder bespuckten. Wir sahen aus wie ein dreckiger Elendshaufen, da ja keiner mehr gewaschen oder rasiert war. Viele hatten zerrissene Verbände.
Anschließend wurden wir wieder in die Waggons verfrachtet. Wir fuhren dann bis Gorki in ein Quarantänelager. Dort spürte man überhaupt nichts vom Krieg. Hier bekamen wir endlich alles, was einem Gefangenen eigentlich zustand. Wir wurden verpflegt und konnten uns nach langer Zeit noch einmal waschen. Allerdings wurde uns auch alles abgenommen, was wir noch bei uns trugen. Unsere Wehrmachtskleidung, die von sehr guter dicker Qualität war, wurde ausgetauscht gegen ganz dünne, abgetragene Leinenkleidung. Drei Wochen blieben wir dort.
Am letzten Tag bekamen wir für einen ganzen Tag Verpflegung und dann ging es morgens um 4 Uhr los. Wir mussten wieder einen ganzen Tag bis in die Früh des nächsten Tages zu einer Bahnstation marschieren. Dort standen Waggons auf freier Strecke, die auch schon mit anderen Gefangenen wie z.B. Polen belegt waren. Wir wurden verfrachtet und nach Perm gebracht (Anm. 1500 km nord-östlich von Moskau, ca. 4000 km von der Heimat entfernt). Dort wurden Waggons mit 500 Mann von uns abgekoppelt, die anderen, wir waren insgesamt 2000 Gefangene, fuhren weiter in Kohlbergwerke im Ural. Ich bin in Perm geblieben.
WiF: Wie sah es in dem Gefangenenlager aus und wie war der Alltag eines russischen Kriegsgefangenen ?
Matthias Korth: Das Lager in Perm bestand aus 6 oder sieben alten Holzbaracken. Die Baracken waren voller Ungeziefer, Wanzen, die aussahen, wie kleine Marienkäfer. Überall an den Balken und Wänden krabbelten die Viecher rauf und runter. In der ersten Nacht konnte man gar nicht schlafen, weil das Ungeziefer ständig an einem herumkroch und stach. In der zweiten Nacht bin ich dann aber doch übermüdet eine längere Zeit eingeschlafen. Als ich dann am nächsten Morgen wach wurde, war ich voller Blut an Armen und Beinen und im Gesicht, als wenn die Wespen mich zerstochen hätten. Alles war dick angeschwollen von den vielen Stichen. Wir haben uns dann abends immer die Kleidung an Armen, Beinen und allen möglichen Öffnungen mit Gras zugebunden, wir hatten ja keine Kordel. Und alles was wir von den Wanzen erwischen konnten, haben wir kaputt geschlagen, um nicht ständig gestochen zu werden. Es gab ja auch nichts zum Zudecken, auch nicht im Winter. Wir schliefen auf blanken Brettern, dicht nebeneinander. Vom harten Liegen waren wir an den Beckenknochen schwarz und blau.
Die erste Zeit bekamen wir nur Suppe mit klarem Wasser mit ein paar Kartoffelschalen drin. Die meisten hatten aber nichts, wo sie ihre Suppenration hineintuen konnten. Einige hatten noch ein Kochgeschirr und liehen den anderen dann Deckel, andere hielten ihre Mützen hin und musste sich dann beeilen, die Suppe zu essen. Es gab ja auch keine Löffel. Viele hatten sich dann mit Stacheldraht aus Tankholz, so kleinen Birkenholzstücken, die die Russen für ihre Holzvergaser brauchten, eine Art Löffel geritzt bzw. gebohrt und aßen dann damit die Suppe.
Im Lager gab es einen Kommandanten, einen Oberleutnant, der auf Krücken ging. Er war viermal verwundet worden und hatte das Gesicht voller Narben. Er war ein absoluter Deutschenhasser und froh um jeden Deutschen, der starb, dass wieder einer weniger war.
Wir wurden aufgeteilt in Hundertschaften. Morgens noch im Dunkeln in der Früh bekamen wir unsere Suppenration und anschließend mussten wir antreten. Dann wurde erst einmal gezählt. Ich kann heute noch gut auf Russisch zählen, da immer wieder durchgezählt wurde, dass ja keiner fehlte.
Jeden Monat wurden alle Gefangenen untersucht, man wurde gesundheitlich bewertet mit 1 bis 5. Eine 1 erreichten nur diejenigen, die gut genährt und gesund waren, das waren die wenigen Kommandanten und Köche. 2 und 3 waren die Arbeitskommandos, ich war meistens noch bei 3. 4 waren die Kranken, die nur noch für leichtere Arbeit gebraucht werden konnten. Und 5 waren schwer Kranke und Sterbende
Dann bekam man Posten zugewiesen. Die meisten haben bei der Arbeit nicht getrieben, aber man war sehr darauf bedacht, dass nur keiner abhanden kam. Das war das Wichtigste, da sie selbst für die Anzahl der Gefangenen unterschrieben hatten. Die Arbeit war unterschiedlich, wir wurden überall eingesetzt.
In Perm wurden neue Fabriken aus der Erde gestampft, so auch ein großes Motorenwerk. Stalin ließ hier Industrie aufbauen, die wegen der Front um Moskau herum abgezogen worden war. Dafür mussten wir auf dem Bahnhof Waggons aus- und einladen oder im Sägewerk arbeiten. Wir haben auch auf den Kolchosen gearbeitet.
Die, die im Wald arbeiten mussten, blieben dann in Zwischenlagern im Wald. Dort habe ich auch eine Zeit gearbeitet. Wir mussten dort mit der Hand Holz aufarbeiten, 5 Festmeter pro Tag. Das lief alles streng nach Norm. Wenn wir das geschafft haben, bekamen wir 200 Gramm trockenes Brot zusätzlich. Dafür haben wir uns natürlich hart gearbeitet. Und das bei hohen Minusgraden. Von den 50 Arbeitern, zum Teil ehemalige Unteroffiziere oder Feldwebel, brachte es keiner fertig, Feuer zu machen, um sich ein wenig zu wärmen. Ich machte mich dann daran, aus etwas Tannenreisig Feuer zu machen. Das musste schnell gehen, denn wenn man die Handschuhe auszog, die wir bekommen hatten, weil es so kalt war, dauerte es nicht lange, bis dass man Erfrierungen hatte. 4 meiner Zehen sind bei der Arbeit damals erfroren.
Wir bekamen auch dickere Mäntel zugewiesen. Doch als ich einmal meine Essensrationen holen war, hat mir jemand das Mantelfutter herausgetrennt. Ich bin dann krank geworden und bekam Lungenentzündung. Auch als ich schwer krank im Schuppen lag, bekam ich nur eine dünne Decke zum Zudecken. Ich hatte hohes Fieber und die Bretter zitterten unter meinen Fieberschüben. Ich hörte noch, wie ein anderer meinte : „Das ist der nächste, der herausgetragen wird“. Es wurden ja laufend Gefangene herausgetragen.
Jeden Tag starben welche. Das Bisschen, was sie anhatten, wurde ihnen ausgezogen und dann wurden die Toten nackt in einen Schuppen geworfen. Und wenn genug zusammengekommen waren, kam ein Wagen und die Toten wurden aufgeladen. Dann mussten ein paar von uns mitgehen und die Toten im Wald verscharren. In einem Jahr war ungefähr die Hälfte der Gefangenen tot. Die meisten sind verhungert. Viele bekamen Wasser in den Beinen von der schlechten Ernährung. Das stieg dann bis in den Bauchraum und irgendwann waren sie tot.
WiF: Hatten Sie Kontakt nach Hause und gab es Freundschaften unter den Gefangenen?
Matthias Korth: Einmal hieß es, wir könnten nach Hause schreiben. Wir bekamen eine Papiertüte, die wir uns teilen mussten. Jeder bekam ein kleines Stück, auf dem wir etwas aufschreiben konnten. Dann mussten wird das Tütenstück falten, wie einen Briefumschlag und mit der Adresse versehen. Einen Monat später musste einer von uns bei den Posten im Zimmer sauber machen. Da hat er die Kiste mit unseren Briefen gefunden. Es war nie eine Nachricht von uns nach Hause gelangt.
Freundschaften kamen während der Zeit im Lager nicht wirklich zustande. Es war alles zu brutal, es ging nur ums Überleben, jeder kämpfte für sich. Natürlich waren der Hunger und die Hoffnungslosigkeit unter den Gefangenen das Schlimmste im Lager.
Aber auch die Eintönigkeit und die geistige Verdummung machten mir schwer zu schaffen, viele sind deshalb auch regelrecht verrückt geworden. Dennoch habe ich nie den Glauben daran verloren, wieder nach Hause zu kommen. Ein Gefangener sagte einmal :“ Wenn ich jemals wieder nach Hause komme, dann werde ich schon glücklich sein, wenn ich nur genug trockenes Brot und kaltes Wasser habe. Nie mehr werde ich mich über irgendetwas beschweren“. Und obwohl ein Tag wie der andere war, sonntags wie werktags, haben wir das Datum nachgehalten. Das war mir wichtig.
Überlebt habe ich nur, weil ich mir immer zu helfen gewusst habe, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war. Aber ich hatte schon als Kind zu Hause viel mitgearbeitet. So hatte ich mir Anfang der Gefangenschaft aus dem Stiehl vom Löffel eine Art Messer gemacht. Beim Barackenbau hatte man ja Werkzeug und da habe ich den Stiehl gedengelt wie eine Sense. Mit dieser Schneide habe ich mir einmal bei der Arbeit auf dem Bahnhof, als wir nachts Kisten mit Speck für die Russen ausladen mussten, eine Kiste aufgebrochen und ein Stück Speck abgeschnitten. Allerdings habe ich davon Durchfall bekommen, weil man ja das Fett nicht mehr gewohnt war. Für den Durchfall habe ich mir dann auf dem Boden Kamille gesammelt. In der Küche habe ich mir etwas heißes Wasser erbettelt, damit habe ich mir eine Art Tee gemacht. Das hat geholfen.
Als meine Kleidung zerrissen war, habe ich mir aus einem Stück Kupferdraht, in das ich mit der Schneide eine Öse reingemacht hatte, eine Art Nähnadel gemacht und mit einem Faden, den ich aus einem anderen Stück Stoff herausgetrennt hatte, die Kleider zusammengenäht. Die anderen schauten zunächst abfällig. Vielen war ihre Situation absolut gleichgültig, andere machten mir meine Vorgehensweise dann aber nach. So sammelte ich auch Brennnessel, um sie als Einlage in die Suppe zu tun. Als die anderen das auch machten, sahen die Wächter das und es gab Ärger. Überhaupt ist es unvorstellbar, was man alles macht, wenn man Hunger hat. Wir haben gegessen, was überhaupt irgendwie zu essen war. Einmal sah ich, wie ein Gefangener sein eigenes Erbrochenes wieder aufaß.
Während der Arbeit auf einer Kolchose durften wir auch rohe Kartoffeln essen. Wir durften sie allerdings nicht mit ins Lager nehmen. Da habe ich die Kartoffeln klein geschnitten und am Körper verteilt. Allerdings haben andere die Kartoffeln einfach in die Tasche gesteckt. Als sie dann abgetastet wurden, hat man die Kartoffeln natürlich gefunden. Daraufhin hat man mich auch noch einmal genauer abgetastet und die Scheiben gefunden. Der Wachposten war wütend und wollte mich daraufhin mit dem Gewehrkolben auf den Kopf schlagen. Ich konnte zwar ausweichen, er traf mich aber noch an der Nase und schlug mir überdies noch zwei Zähne raus. Beim nächsten Mal habe ich es trotzdem wieder versucht. Ich wollte ja überleben.
WiF: Wann und wie wurden Sie aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und wie war der Weg nach Hause?
Matthias Korth : Ich blieb bis Oktober 1945 in diesem Lager. Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt ja schon ein halbes Jahr vorbei. Es wurde gerade wieder eine monatliche Untersuchung im Lager durchgeführt. Weil damals so viele starben, hatte man eine neue Ärztin geschickt. Ich musste mich nackt vorstellen und da meinte die Ärztin „malenʹkiĭ khorosh“, was so viel heißt wie „Kleiner gut“. Da entgegnete ich: „Ich bin so schlapp, ich kann mich kaum auf den Beinen halten“. Der deutsche Lagerarzt bestätigte dies und wies noch auf die Lungenentzündung hin, die ich gerade erst überstanden hatte. Daraufhin hat man mich 4 geschrieben und ich kam aus dem Wald zurück ins Hauptlager.
Dort hörte ich, dass ein Transport zusammengestellt wurde mit Schwerstkranken, die nach Hause durften. Ich überlegte noch, ob ich mich überhaupt melden sollte, da ich ja noch leichte Arbeit verrichten konnte. Ich habe es dann trotzdem einfach probiert. Und tatsächlich hat man mich dann für den Heimtransport aufgeschrieben, da ja alles immer streng nach Zahlen lief und der Transport eine bestimmte Anzahl umfassen sollte. Acht Mann fehlten noch. Ich hatte einfach Glück, dass ich mit nach Hause durfte, zumal ich noch am besten dran von allen, die Heim geschickt wurden.
Für diesen Transport wurden Gefangene aus verschiedenen Lagern zusammengestellt. Auf dem Heimweg sind dann auch wieder viele gestorben, die einfach zu krank und geschwächt waren. Bei dem Heimtransport war ein evangelischer Pfarrer dabei. Er hatte sich die Namen der Gefangenen aufgeschrieben, die gestorben waren. Der Zettel wurde ihm aber weggenommen, damit keiner von den Toten erfuhr. Da er damit aber schon gerechnet hatte, hatte er sich die Namen noch einmal aufgeschrieben und den Zettel im Schuh versteckt. So konnte er wenigstens in der Heimat mitteilen, wer verstorben war.
Auf dem Weg nach Hause fuhren wir in offenen, unbewachten Waggons. In Ost-Berlin wurden wir entlassen mit russischen Entlassungszetteln. Am Bahnhof wollten wir in andere Waggons umsteigen. Die waren aber alle überfüllt, so dass wir nur auf den Puffern sitzen konnten und so bis Frankfurt Oder gefahren sind. Dort kamen wir in ein englisches Quarantänelager, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Nach drei Wochen ging die Fahrt weiter.
Richtige Freude kam unter uns nicht auf, da wir ständig Angst hatten, wieder inhaftiert zu werden. Nach langer Fahrt kamen wir in Bonn auf dem Hauptbahnhof an. Überall standen Soldaten herum, die aus der Kriegsgefangenschaft kamen. Die aus der ehemaligen russischen Gefangenen erkannte man sofort. Sie waren im Gegensatz zu den anderen heruntergekommen und abgemagert.
In einer Gruppe fiel der Begriff „Blankenheim“. Ich fragte direkt nach, wer denn aus Blankenheim von ihnen käme. Derjenige, der von Blankenheim gesprochen hatte, sah genauso elendig und krank aus wie ich. Wir standen uns gegenüber und kannten uns nicht, zumal ich zu diesem Zeitpunkt nur noch 45 Kilo wog. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir uns erkannten. Es war Mülle Pitter ( Anm. Peter Birk aus der Freilinger Mühle). Es war der erste Freilinger, den ich nach meiner Heimkehr zu Gesicht bekam. Wir fuhren dann zusammen bis Euskirchen noch mit dem Zug. Von da an mussten wir zu Fuß nach Hause marschieren. Wenn es bergauf ging, musste ich Pitter noch schieben bzw. ziehen, weil er sonst den Heimweg nicht geschafft hätte. In Ohlenhard hat uns eine Frau noch zu einem Kaffee hereingebeten. Sie hatte Mitleid mit den zwei zerlumpten Soldaten. In Freilingen hatte sich die Neuigkeit, dass wir heimkehren würden schon herumgesprochen, da andere Soldaten, die aus englischer Gefangenschaft heimgekehrt waren, vor uns zurück waren.
Meine Familie war natürlich überglücklich, als ich heimkam. Mein Vater machte mir sofort ein Bad zurecht. Meine zerlumpten Kleider haben wir ins Feuer geschmissen, auch die „Schuhe“, Stofffetzen, die ich mit Draht um meine Füße gebunden hatte. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass der Tag meiner Rückkehr für immer ein kleiner Feiertag sein sollte. Aber schon nach einem Jahr wurde das nicht mehr gefeiert. Selber denke ich aber jedes Jahr an diesem Datum daran, wie es war, als ich nach Hause gekommen bin.
Die erste Zeit nach meiner Heimkehr hatte ich nachts schwere Albträume. Immer wieder hatte ich die Bilder von den Kämpfen und der Gefangenschaft vor mir. Erst später, als ich geheiratet habe und Kinder bekam, ließ das nach.
Mit 65, als ich dann meine Rente bekam, habe ich auf dem Amt nachgefragt, ob und wie denn diese Zeit als Soldat und Gefangener auf meine Rente angerechnet würde. Dies verneinte man, da ich vorher nicht in die Rentenkasse eingezahlt hatte. Dass ich zu diesem Zeitpunkt noch ein Kind war und gar nicht hätte einzahlen können, interessierte niemanden. Überhaupt habe ich zu keinem Zeitpunkt staatlicherseits Dank oder Anerkennung erfahren.
Mir hat einmal jemand gesagt: “Der Dank des Vaterlandes wird euch immer begleiten … aber nie erreichen“.
Das ist traurig, aber wohl wahr.